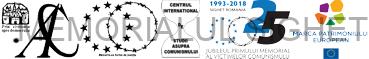În 29 august 2004 a apărut în ziaul Frankfurter Allgemeine Zeitung un articol semnat de Karl-Peter Schwarz în care este prezentat pe larg Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei şi este relevată importanţa lui în procesul comunismului din România.
Frankfurter Allgemeine SONNTAGSZEITUNG, 29. August 04
Seite 8
In der schwarzen Zelle
Wie Rumänien der vielen Opfer der Securitate gedenkt: Besuch in Sighet
Von Karl-Peter Schwarz
Sighet. Im Frühjahr 1962 legte eine Dame aus Bukarest vor einer Statue in New Yorks Central Park einen Kranz nieder. Das Denkmal zeigt Samuel Morse neben seinem elektrischen Telegraphen, in der rechten Hand hält er einen Streifen mit seinem Code. Dieser Code sei es gewesen, sagte die rumänische Besucherin, der ihre beiden Töchter Nora und Ana Samuelli wie Zehntausende weitere politische Häftlinge davor bewahrt habe, in den kommunistischen Gefängnissen den Verstand zu verlieren. Rumänien war nach dem Krieg buchstäblich verstummt. Während die sowjetischen Besatzer und ihre Kollaborateure ein Terrorregime errichteten, füllten sich die Gefängnisse mit Politikern, Wissenschaftlern, Literaten, Ärzten, Priestern, Unternehmern, Bauern. Praktisch die gesamte Elite der Nation war in ihrer Kommunikation von Zelle zu Zelle auf den streng bestraften, aber nicht gänzlich zu verhindernden Austausch von Klopfzeichen reduziert worden.
Sighet (Sighetu Marmatiei), im Frühjahr 2004. Im Büro der “Bürgerakademie” – es ist in einem früheren Gefängnis von Sighet untergebracht, das heute in eine Gedenkstätte für die Opfer des Kommunismus umgewandelt ist – erscheint Alexandru Satmari, der hier früher als politischer Offizier der Securitate beschäftigt war. Es befänden sich, sagt er, noch zwei Erinnerungsstücke aus seiner Dienstzeit in seinem Besitz, von denen er glaube, daß sie für die Gedenkstätte von hohem Wert seien. Er sei bereit, sie für die vergleichsweise geringe Summe von 700 Dollar auszuhändigen, was doch gewiß nicht zuviel sei für den Hut und den Spazierstock, die dem prominentesten Häftling von Sighet gehört hätten: Iuliu Maniu, dem Führer der Bauernpartei. Der Mitarbeiter der Akademie weist Satmari die Tür.
Für Rumänien ist Maniu, was Adenauer für Deutschland und De Gasperi für Italien ist – ein Staatsmann, dessen Name für eine epochale Wende steht. Als Abgeordneter im ungarischen Reichsrat war Maniu vor dem Ersten Weltkrieg für die rumänische Autonomie in Siebenbürgen eingetreten; das 1918 entstandene Rumänien war zu einem großen Teil sein Werk. In der Zwischenkriegszeit war er dreimal Ministerpräsident. Der Diktatur Ion Antonescus widersetzte er sich, stand aber beim Volk in so hohem Ansehen, daß das Regime es nicht wagte, ihn verhaften zu lassen. Als ihn der tschechoslowakische Exil-Präsident Edvard Benes im Herbst 1943 in einem Brief aufforderte, seinem Beispiel zu folgen und einen “Ausgleich mit Stalin” zu suchen, wies ihn Maniu scharf zurück: Die einzige Haltung, die man den Kommunisten gegenüber einnehmen könne, sei der offene Widerstand.
Manius sterbliche Überreste liegen auf einem Armenfriedhof am Rande von Sighet, wo genau, weiß man nicht. Die Familie hat auf dem Feld ein hohes Holzkreuz errichtet. Manius Leiche wurde in einer Februarnacht des Jahres 1953 mit einem Pferdewagen aus dem Gefängnis transportiert und verscharrt. Er war achtzig Jahre alt gewesen, als er in der kalten Zelle 9 in Einzelhaft starb, schlecht verpflegt und ohne medizinische Betreuung. Im August 1951 hatte man ihn und die anderen Führer der Bauernpartei nach Sighet gebracht, das aufgrund der Grenznähe für die Elite des Landes erwählt worden war. Im Falle von Unruhen hätte man die Gefangenen in kurzer Zeit in die Sowjetunion schaffen können. Am 7. Mai 1950 waren die ersten 83 Häftlinge eingetroffen; drei Wochen später wurden Bischöfe und Priester der mit Rom unierten rumänischen Kirche des byzantinischen Ritus nach Sighet gebracht. Gegen Ende des Jahres gab es hier schon etwa 250 Gefangene, jeder vierte von ihnen sollte im Gefängnis sterben.
Klausenburg (Cluj), im Sommer 2004. Eugen Popa holt aus einem Bücherregal eine kleine Broschüre, in der er sein Zeugnis des Martyriums der siebenbürgischen Unierten zusammengefaßt hat: die Verhaftung, die Schläge, die Drohungen, um die Unierten zum Eintritt in die orthodoxe Kirche zu bewegen, schließlich die Haft in Sighet, Zelle 14. Dort habe er nicht damit gerechnet, lange zu überleben, erzählt der 91 Jahre alte Priester, aber er sagt es so leise, als hätte das Leid ihn persönlich nicht betroffen. Popa war 1948 verhaftet worden; entlassen wurde er erst sieben Jahre später. Er arbeitete dann im Sanitätsdienst und wirkte als Seelsorger im Untergrund. Als die unierte Kirche Anfang der neunziger Jahre wieder legalisiert wurde, war er bereits zu alt, um eine Pfarre übernehmen zu können.
Popa hält nichts davon, vor weltlichen Gerichten Anklage zu erheben, denn “Herr Jesus Christus hat uns gelehrt, denen zu verzeihen, die uns verfolgen”. Einen ehemaligen Aufseher habe er lange nach seiner Entlassung auf der Straße getroffen, “wir haben uns ganz normal miteinander unterhalten”. Unter den Wächtern habe es von Natur aus härtere und weniger harte Menschen gegeben, wie überall. In den Zellen durften die Gefangenen tagsüber weder sitzen noch liegen, alle zehn Minuten kam ein Aufseher vorbei und kontrollierte. Die Nacht über brannte Licht. Auf jede Art von Kontakt standen strengste Strafen, wer dabei ertappt wurde, Klopfzeichen zu geben, wurde in die “schwarze Zelle” gesperrt, in der die Häftlinge angekettet oft mehrere Tage oder Wochen in völliger Dunkelheit ausharren mußten, bis in ihnen jedes Zeitgefühl erstorben war. Popa war mehrmals in der “schwarzen Zelle”, einmal, weil er vom Rand einer Schüssel die Polenta-Kruste abgekratzt und seinen Zellengenossen gegeben hatte. “Sie haben uns aber auch oft völlig grundlos bestraft, zum Beispiel, weil gerade Nationalfeiertag war.” Direktor Vasile Ciolpan, der solche Strafen verhängt hat, lebt noch in Sighet. Die Regierung wollte ihm sogar einen Orden verleihen, aber das Vorhaben scheiterte am Protest der ehemaligen Gefangenen.
Stephane Courtois, einer der Autoren des “Schwarzbuchs des Kommunismus”, hat die Gedenkstätte in Sighet anderen postkommunistischen Ländern als Vorbild empfohlen. In dem Gefängnis ist ein Museum untergebracht und ein internationales Studienzentrum, das die Aussagen von Zeitzeugen sammelt sowie Symposien und Sommerkurse organisiert. Rumänien verdankt diese Initiative der Dissidentin Ana Blandiana, die sie vor zehn Jahren mit Unterstützung des Europarates gegen beträchtlichen politischen Widerstand durchsetzen konnte. Noch 1995 hatte ein rumänisches Gericht die Klage der Tochter Traian Murarius zurückgewiesen, eines Bauern, der hingerichtet wurde, weil er 1951 zwei Widerstandskämpfer beherbergt hatte.
Flüchtlinge wie Ana Samuelli haben einzelne Verbrechen der rumänischen Kommunisten schon bald im Westen bekannt gemacht. Aber erst Studien, die nach 1989 angestellt wurden, lassen das Ausmaß der Repression und des Widerstandes erahnen, gegen den das Regime zeitweilig an die 100000 Soldaten der Miliz und der Securitate einsetzte. Auf einer Mauer im Gefängnishof von Sighet sind die Namen von 8000 identifizierten Todesopfern verzeichnet, und immer noch kommen zahlreiche neue dazu. 1962 erschoß die Securitate im Banat den letzten bewaffneten antikommunistischen Widerstandskämpfer. Dutzende autonome Gruppen konnten sich mit Unterstützung der Bauern in den Bergen jahrelang halten. Zunächst schlossen sich ihnen ehemalige Offiziere und lokale Honoratioren an, dann vor allem Bauern, die sich der Kollektivierung und den Deportationen widersetzten.
Die 76 Jahre alte Lucretia Jurj hatte sich 1950 mit ihrem Ehemann, einem Forstbeamten, der Gruppe Susman angeschlossen. Sie hätten damals, erzählt sie, die amerikanischen Rundfunksender abgehört und mit einem bal
digen Krieg gerechnet, der einen Aufstand auslösen würde. Vier Jahre lang überwinterten sie in verschneiten Hütten, hungerten oft wochenlang, überlebten Feuergefechte mit der Securitate und entkamen wie durch ein Wunder, als sie von 2500 Soldaten eingekesselt waren. Erst durch Verrat konnte die Gruppe zerschlagen werden. Lucretias Mann wurde erschossen. Die damals 26 Jahre alte Frau wurde zu lebenslänglicher Haft verurteilt und erst 1964 amnestiert – an TBC erkrankt, so daß ein Teil ihrer Lunge entfernt werden mußte. Sie kam als Näherin in einer Textilfabrik unter.
Über ihre Vergangenheit, sagt Lucretia Jurj, habe sie erst nach 1989 offen gesprochen. Indes hat sie ein Buch über ihr Leben veröffentlicht, hält Vorträge, besucht Schulen und Hochschulen, ist stolz auf ihre Enkelin, die in Deutschland studiert. Es seien, sagt sie, in Rumänien immer noch dieselben Leute an der Macht, die ihr das alles angetan hätten. Und warum lassen die Rumänen das zu? “Weil unser Volk so sanftmütig ist”, sagt sie und lächelt.